Dipl.-Informatiker (TU) Heinz Deininger im Interview
Heinz Deininger aus Löwenstein ist studierter Informatiker und war mehr als 30 Jahre als Systemingenieur im IT-Bereich tätig. Neben seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Vorstand des „Freundeskreis ehemalige Synagoge Affaltrach“ repräsentiert er die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Heilbronn. Der Heilbronner Kreisverband von DIE LINKE ernannte den parteilose Deininger außerdem zu ihrem Bildungsbeauftragten. Wir haben mit ihm über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Rechte von Arbeitnehmer*innen und Heilbronns Selbstbild als künftige KI-Stadt gesprochen.
„Betriebsräte und Gewerkschaften sind gefordert“
Herr Deininger, sie haben bis 2012 viele Jahrzehnte als Informatiker gearbeitet. War künstliche Intelligenz in dieser Zeit schon ein Thema für Sie?
Es gab gewisse Vorläufer: Alle möglichen Varianten der Automatisierung von Produktionsprozessen, aber auch von Kommunikation. Sowohl sprachliche Kommunikation als auch Datenkommunikation. Durch das maschinelle Lernen und neuronale Netze ist nun das Feld entstanden, das wir heute als künstliche Intelligenz kennen.
Wenn Betriebe bestimmte Aufgaben automatisieren, kommt es ja unter Umständen auch zu Konflikten mit den Rechten der Arbeitnehmer*innen. Welche Rolle spielt das im IT-Sektor?
Für Beschäftigte ist es ungeheuer wichtig, sich hier zu engagieren. Wenn es virtuelle Büros gibt, Arbeitszeiten geändert werden, dann müssen Beschäftigte maximal eingebunden werden. Sowohl in die Planung als auch in die Umsetzung. Da sind Betriebsräte und Gewerkschaften gefordert. Und die müssen sich heute natürlich auch mit Themen wie KI auskennen.
Sind Gewerkschaften und Betriebsräte für diese Aufgaben gewappnet?
Sie kämpfen wacker, würde ich sagen. Allerdings spielen sie in IT-Berufen häufig eine geringere Rolle als anderswo, weil dort eher jeder sein eigener Kleinunternehmer ist. Soweit ich das sehe, nimmt die Präsenz aber aktuell zu. Und das ist gut so, denn es ist wichtig, dass Beschäftigte schon an der Gestaltung der Transformation mitwirken. Sonst wird einem etwas vorgesetzt, das man nur noch abnicken kann.
Wie funktioniert das bei einem globalen Großthema wie KI?
Die rasante Geschwindigkeit der Entwicklung ist ein Problem. Startups sprießen aus dem Boden, neue Modelle entstehen. Ehe sich Arbeitnehmervertreter da engagiert haben, ist die Technologie schon in die übernächste Runde gegangen.
Sorgen KI-Anwendungen ihrer Ansicht nach für Verbesserungen am Arbeitsplatz selbst oder dienen sie vor allem dazu, Menschen aus Kostengründen wegzurationalisieren?
Wie viele technische Neuerungen hat auch KI eine positive Seite, die Menschen die Arbeit erleichtern kann. Aber es gibt eben auch die andere Seite: Unternehmen wollen Personal ausdünnen und so Kosten senken. Beide Seiten muss man kennen und als Arbeitnehmervertretung eine langfristige Strategie dafür entwickeln.
„KI durchläuft derzeit die für die Tech-Branche typischen Hype-Zyklen“
In Bezug auf KI ist häufig die Rede davon, dass zwar möglicherweise alte Berufsbilder wegfallen, dafür aber neue entstehen. Sollte einen das positiv stimmen?
Diese Entwicklung hatten wir in der Geschichte des technologischen Fortschritts ja bereits häufig. Früher hat man auf dem Feld alles von Hand gemacht, durch die Anschaffung eines Traktors ändert sich dann meine Arbeit. Ganz wichtig ist aber, dass solche Entwicklungen sozial verträglich geschehen. Leute müssen umgeschult werden, damit sie weiterhin Chancen haben und keine Ängste um ihre Existenz ausstehen müssen.
Heilbronn galt viele Jahrzehnte als klassische Industriestadt, nun hat sie sich selbst das Label als Zentrum für künstliche Intelligenz gegeben. Halten Sie es für sinnvoll, sich so gezielt auf diese Technologie zu konzentrieren?
Ich sehe das kritisch. Denn KI durchläuft ja derzeit diese für die Tech-Branche typischen Hype-Zyklen. Anfangs gibt es ein paar Early Adopter, dann dringt die Entwicklung in die breite Öffentlichkeit. Irgendwann merkt man aber, dass die Erwartungen womöglich zu hoch waren. Bestimmte Entwicklungen kommen doch nicht, weil sie zu teuer oder nicht umsetzbar sind. Der Hype sinkt daraufhin in den Keller und irgendwann pendelt sich alles auf einem mittleren Level ein. Deshalb sollte Heilbronn sich nicht auf dieses eine Thema verengen, denn die Stadt wird in Zukunft nicht nur von KI leben.
An welche anderen Bereiche denken Sie da?
Die ganz normale Stadtentwicklung zum Beispiel, die Attraktivität der Innenstadt. Und auch an Maßnahmen gegen den angespannten Wohnungsmarkt. Denn die tragen zu einer gesunden Mischung bei, zwischen gutverdienenden Leuten aus der Tech-Branche und Menschen, die nicht so viel Einkommen haben. Auch bei der Investition in Schulen und öffentliche Einrichtungen muss mehr gemacht werden, damit die Stadt insgesamt attraktiv bleibt. Dann kann man immer noch KI mal als Leuchtturmprojekt herausstellen.
„Ich glaube nicht, dass Beschäftigte autonome Bomben herstellen wollen“
Wer entscheidet, worauf unser Fokus liegt?
Das Thema KI wird ja global von großen Tech-Firmen wie Microsoft oder Google vorangetrieben. In Heilbronn haben wir das starke Engagement der Schwarz-Stiftung, was ich kritisch sehe. Denn wer das Geld gibt, hat das Sagen – das ist kein sehr demokratischer Prozess. Aber gerade ein Thema wie KI muss vor allem auch die Zivilgesellschaft beeinflussen können.
Im Sinne der Sicherung von Arbeitsplätzen?
Auch, aber nicht nur. Ich denke da zum Beispiel auch an den militärischen Bereich. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass alle Beschäftigten es gut fänden, wenn ihr Unternehmen autonome Bomben herstellt, die sich per KI ihre Ziele suchen. Die Frage, wofür künstliche Intelligenz genutzt wird – und wofür nicht – ist ebenfalls eine ganz wesentliche Aufgabe von Gewerkschaften.
Wie sollten Arbeitnehmer*innen in Heilbronn ihrer Meinung nach mit dem Thema KI umgehen?
Das setzt drei Phasen voraus. Erstens sollte man sich mit KI beschäftigen. Man muss wissen, wohin die Entwicklung geht, was wird sie können und was nicht. Zweitens müssen Beschäftigte wissen, wo und warum KI in ihren Betrieben eingesetzt wird. So kann man sich gegen Maßnahmen wie Stellenstreichungen wehren – oder auch selbst Ideen einbringen, wie KI den Arbeitsalltag erleichtern könnte. Und drittens müssen sowohl die Zivilgesellschaft als auch Gewerkschaften ein kritisches Auge darauf haben, welche Entwicklungen sie nicht wollen. Zum Beispiel Gesichtserkennung, öffentliche Personenkontrolle, Überwachung. Und zwar jetzt – denn jetzt findet die Entwicklung statt.
Interview: Florian Deckert | Illustration: Foto von Cash Macanaya auf Unsplash

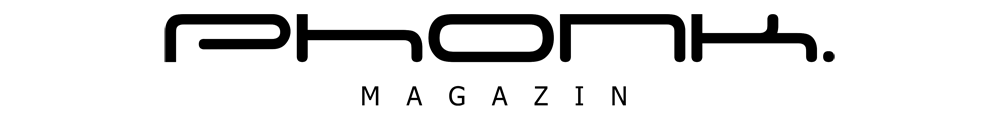



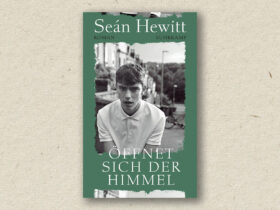





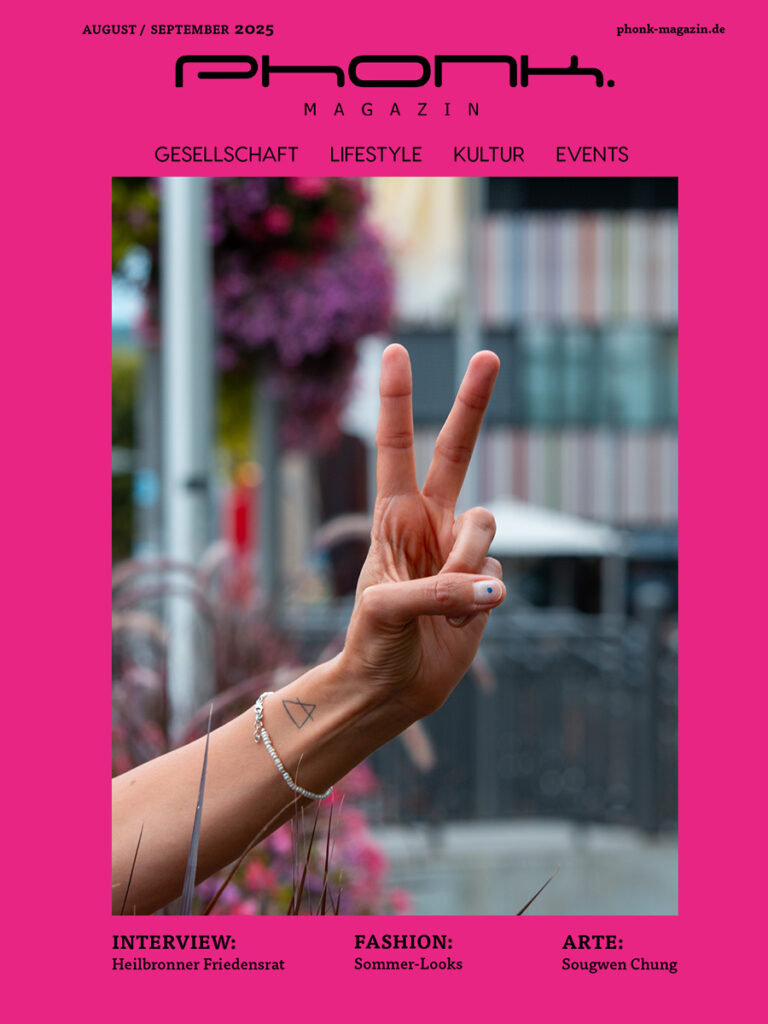




Einen Kommentar hinterlassen